Nachdem die Bundesregierung ihren Haushaltsentwurf vorgelegt hatte – haben wir ihn in dieser Woche in erster Lesung im Bundestag beraten. Doch neben dem Haushalt 2025 stand vor allem ein anderes Thema im Fokus dieser Woche: die geplante Wahl zur Neubesetzung von drei Richterstellen am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Als SPD hatten wir Jura-Professorinnen Frauke Brosius-Gersdorf und Ann-Katrin Kaufhold nominiert, die Union schlug Günter Spinner vom Bundesarbeitsgericht vor. Am Tag der geplanten Abstimmung am Freitag wurde die Wahl kurzfristig wieder von der Tagesordnung abgesetzt. Das Problem war, dass die Unionsführung die nötige Mehrheit in ihren eigenen Reihen nicht mehr sicherstellen konnte. Natürlich ist es legitim, kritische Stimmen und Bedenken im Vorfeld zu äußern, doch wie dies in der öffentlichen Debatte nun geschieht, belastet nicht nur das Verfahren, sondern schadet auch dem Ansehen der parlamentarischen Arbeit insgesamt. Die Nominierungen lagen seit Wochen auf dem Tisch und alle Fraktionen hatten genügend Zeit, sich mit den Vorschlägen auseinanderzusetzen. Dass nun auf den letzten Metern ausgerechnet Argumentationsmuster und Vorwürfe der AfD übernommen werden ist befremdlich. Noch befremdlicher ist es, dass die AfD nun versucht, sich die Verschiebung der Verfassungsrichterwahl als eigenen „Erfolg“ anzurechnen.
Agrarhaushalt 2025: Für gerechte Agrarsozialpolitik, starke ländliche Räume und eine klimafeste Landwirtschaft
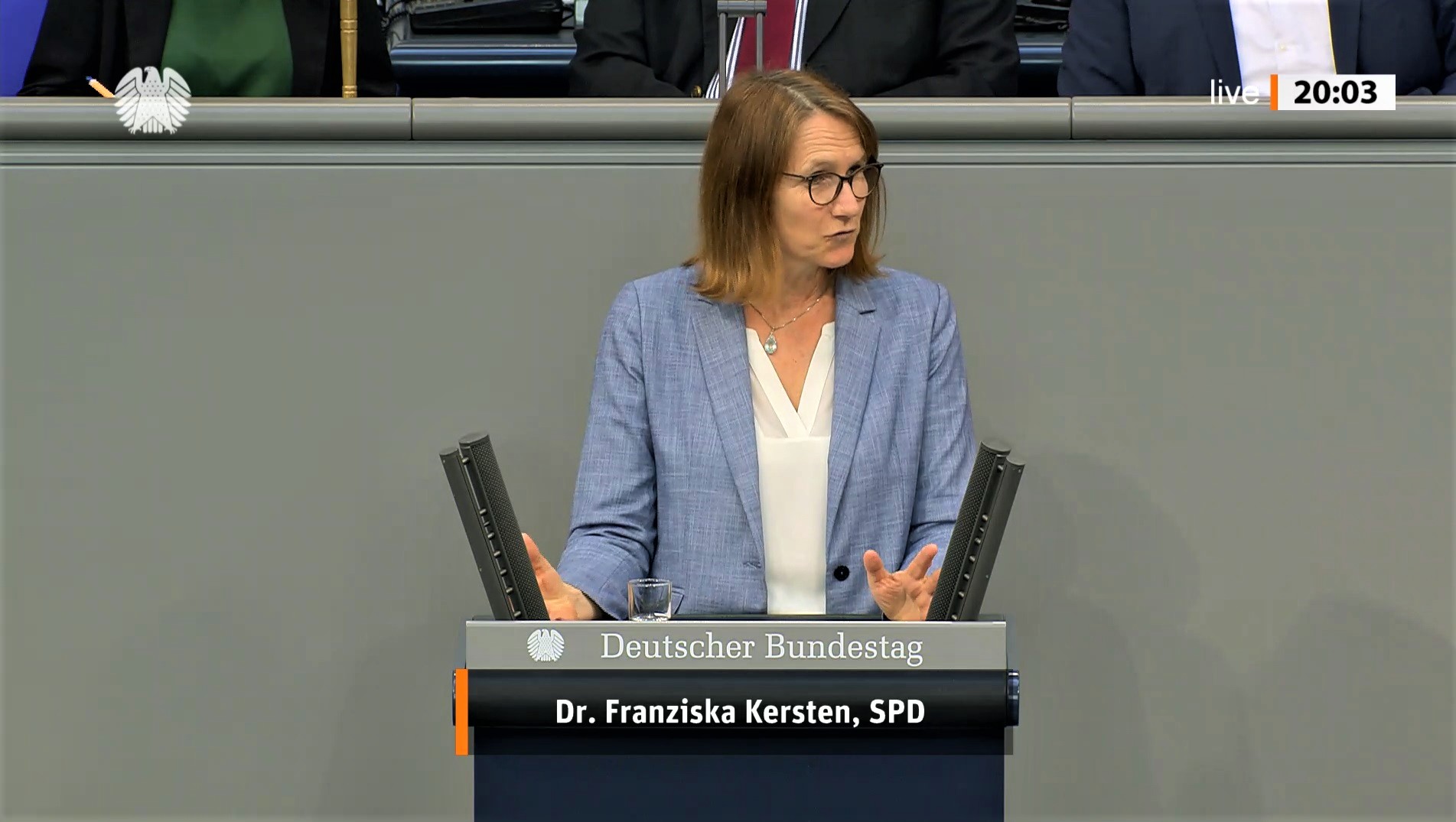
In meiner Rede zum Haushaltsplan für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat habe ich deutlich gemacht, dass es hierbei um nicht weniger als soziale Gerechtigkeit, lebendige ländliche Räume und Gestaltung einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Landwirtschaft. Daher überrascht es nicht, dass der größte Posten des Haushalts für die Agrarsozialpolitik vorgesehen. Wie einige sicher wissen, existiert seit Jahrzehnten ein eigenes Versicherungssystem für die Land- und Forstwirtschaft. Neben der Kranken-, Renten- und Unfallversicherung werden mit diesen Mitteln auch Betreuung und Beratung von Wanderarbeitern und Saisonkräften finanziert. Das ist aus unserer Sicht ein wichtiger Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit auch im europaweiten Kontext.
Ein zweiter wichtiger Punkt ist die sogenannte GAK – die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“. Mit diesem zentralen Förderinstrument für den ländlichen Raum unterstützen Bund und Länder die Entwicklung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Regionen unseres Landes. Für mich ist der ländliche Raum, in dem über die Hälfte unserer Bevölkerung lebt, DER Ort zur Gestaltung einer vielseitigen und nachhaltigen Zukunft. Hier können Menschen sich entfalten, neues ausprobieren, Bewährtes erhalten. Vor allem aber sind vielseitige und wirtschaftlich tragfähige ländliche Räume entscheidende Orte für Engagement, Ehrenamt und eine lebendige Demokratie in unserem Land! Das haben wir schon während der Koalitionsverhandlungen immer wieder betont und genau deshalb fängt das Kapitel Landwirtschaft und Umwelt auch zu Recht mit ländlichen Räumen an! Dass die GAK im kommenden Jahr mit 907 Millionen Euro erneut in voller Höhe abgesichert ist, ist deshalb eine gute Nachricht.
Aber – und das habe ich in meiner Rede auch deutlich gemacht – angesichts wachsender Herausforderungen dürfen wir hier nicht stehenbleiben: Gerade im Hinblick auf die Auswirkungen des Klimawandels kommt einiges auf uns zu: mehr Hitze und Dürre einerseits, Stürme, extremer Regen und Hochwasser andererseits. Ich bin davon überzeugt, dass eine Anpassung an die Folgen des Klimawandels mit den richtigen Instrumenten in Deutschland machbar ist. Im Koalitionsvertrag haben wir bereits gemeinsam vereinbart, einen Sonderrahmenplan für Naturschutz und Klimaanpassung auf den Weg zu bringen und die Schaffung einer neuen Gemeinschaftsaufgabe zu prüfen. Und genau das fordere ich jetzt auch ein. Denn wir müssen heute die Grundlagen dafür legen, dass kommende Generationen in einem stabilen, lebenswerten und klimafesten Land leben können.
Einsetzung der Enquete-Kommission zur Corona-Pandemie
Die Corona-Pandemie war eine tiefe Zäsur. Sie hat nicht nur im Gesundheitswesen Spuren hinterlassen, sondern in nahezu allen Lebensbereichen. Wir wollen verstehen, was gut funktioniert hat – und was nicht. Wir wollen aus Fehlern lernen und unsere Gesellschaft besser auf künftige Krisen und Pandemien vorbereiten. Dabei geht es nicht um politische Schnellschüsse, sondern um eine fundierte, überparteiliche und lösungsorientierte Analyse. Der Kommission werden 14 Abgeordnete sowie 14 externe Sachverständige angehören. Erste Empfehlungen soll sie bis Mitte 2027 vorlegen. Gleichzeitig geht es um gesellschaftliche Heilung. Viele Menschen fühlen sich mit ihren Erfahrungen und Belastungen allein gelassen. Ihre Stimmen sollen gehört werden. Es geht uns nicht um Schuldzuweisungen, sondern um eine ehrliche, sachliche und empathische Analyse. Ein Antrag der AfD, stattdessen einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, wurde zu Recht abgelehnt. Ein Untersuchungsausschuss dient vor allem der politischen und juristischen Aufklärung konkreter Missstände und ist auf die Feststellung von Verantwortlichkeiten ausgelegt. Für eine breit angelegte, zukunftsorientierte Aufarbeitung wie im Fall der Corona-Pandemie ist das nicht das geeignete Instrument. Eine Enquete-Kommission hingegen ermöglicht eine sachliche, interdisziplinäre Analyse mit dem Ziel, Lehren für zukünftige Krisen zu ziehen – im Dialog zwischen Politik und Wissenschaft, über Parteigrenzen hinweg.
Wissenschaft, die Wurzeln schlägt – Agrarforschung als Fundament zukunftsfähiger Politik

Bei der akademischen Feier der Agrarwissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität durfte ich einen besonderen Moment miterleben: die Auszeichnung der besten Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler sowie die Übergabe goldener Promotionsurkunden an Persönlichkeiten, die sich bereits vor Jahrzehnten der Agrarwissenschaft verschrieben haben. An einer der ältesten und renommiertesten Einrichtungen in Deutschland wird hier Forschung nicht nur bewahrt, sondern mit Blick auf die Herausforderungen von morgen fortentwickelt.
Die Themen, mit denen sich bereits Albrecht Thaer beschäftigte – Humusaufbau, Nährstoffkreisläufe, Agrarökonomie – haben bis heute nichts an Relevanz verloren. Für mich ist klar: Agrarpolitik braucht Agrarwissenschaft. Gerade in einem Bereich, der so komplex, dynamisch und systemrelevant ist wie die Landwirtschaft müssen wissenschaftliche Grundlagen verstärkt Eingang in unsere agrarpolitischen Entscheidungen finden. Fachlicher Sachverstand ist im politischen Betrieb allerdings nicht immer zu erwarten, wir beobachten seit langem einen Trend zu Allroundern, die sich in Themen nur kurz einlesen. Als Abgeordnete sind wir mit einer Unmenge an Nachrichten konfrontiert, führen sehr viele Gespräche und nehmen an Podien teil. Hintergründe zu vielen spezifischen Themen recherchieren im Regelfall die Abgeordnetenbüros oder auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages. Fachspezifisch können aber nur die Agrarwissenschaften weiterhelfen. Umso wichtiger ist es, dass wir in Deutschland eine starke agrarwissenschaftliche Forschungslandschaft haben – von der Ressortforschung des BMELH (z. B. Thünen-, Julius-Kühn- und Friedrich-Loeffler-Institut) bis hin zu Wissenschaftsgemeinschaften wie die Leibniz-Gemeinschaft und unseren renommierten Hochschulen und Forschungsinstituten. Ein beeindruckendes Beispiel für praxisnahe Forschung an der HU ist das Projekt Cubes Circle: Hier wird an zukunftsfähigen Agrarsystemen für urbane Räume gearbeitet – modular, ressourceneffizient, technologiegestützt. In einem geschlossenen Kreislaufsystem werden pflanzliche und tierische Produktion zusammengeführt, um auf kleinstem Raum möglichst viele Ressourcen wiederzuverwerten. Ziel ist es, Ernährungssicherheit auch dort zu ermöglichen, wo Platz, Wasser und Nährstoffe knapp sind – in Megacities ebenso wie in urbanen Randlagen. Damit verbindet Cubes Circle Hightech mit Nachhaltigkeit, und Forschung mit gesellschaftlicher Verantwortung.
Parlamentarisches Frühstück zu „Klimawandel & Gesundheit“

Anlässlich des bundesweiten Hitzeaktionstags habe ich die Schirmherrschaft über das parlamentarische Frühstück des Centre for Planetary Health Policy (CPHP) zum Thema „Klimawandel & Gesundheit“ übernommen. Klimawandel und Gesundheit, da denkt man natürlich sofort an das Thema Hitze und extrem heiße Tage wie der Mittwoch vor einer Woche. Allein n den letzten zwölf Monaten hat Deutschland 50 extreme Hitzetage erlebt – doppelt so viele wie ohne den Klimawandel zu erwarten gewesen wären. Das zeigt eine neue Analyse von Climate Central und Partnerorganisationen. Rund die Hälfte dieser Tage ist direkt auf die menschengemachte Erderwärmung zurückzuführen. Schätzungen gehen davon aus, dass in Hitzesommern bis zu 10.000 hitzebedingte Todesfälle auftreten – viele davon wären vermeidbar durch konsequente Gegenmaßnahmen. Besonders betroffen sind vulnerable Gruppen: Ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen oder eingeschränkter Mobilität. Was ich kürzlich gelernt habe und besonders erschreckend fand: Bei hoher Luftschadstoffbelastung wirkt sich Hitze noch stärker auf den Körper aus. Der Grund: Feinstaub gelangt über die Lunge teilweise in den Blutkreislauf und bewirkt dort eine Verengung der Blutgefäße – genau das Gegenteil der eigentlich notwendigen Reaktion bei Hitze, nämlich eine Gefäßerweiterung zur besseren Wärmeregulierung. Der Körper gerät dadurch aus dem Gleichgewicht – mit teils schweren Folgen, vor allem für ältere Menschen oder Personen mit Vorerkrankungen. Saubere Luft ist also auch ein wirksamer Hitzeschutz. Doch der Klimawandel trägt selbst zu steigenden Feinstaubwerten bei. Das zeigt: Wir müssen nicht nur konsequent Klimaschutzmaßnahmen umsetzen, sondern auch unseren Lebensstil anpassen – etwa durch klimafreundliche Investitionen in Infrastruktur mitdenken indem wir zum Beispiel Räume tagsüber mit Solarstrom klimaneutral kühlen. Für mich als Tierärztin ist ein weiterer zentraler Zusammenhang zwischen Klimawandel und Gesundheit die zunehmende Bedeutung von Infektionskrankheiten. Hohe Temperaturen begünstigen deren Ausbreitung, vor allem in ohnehin geschwächten Körpern. In wärmeren Gewässern vermehren sich krankheitserregende Bakterien schneller, auch antibiotikaresistente Keime halten sich länger. Nach Starkregen und Überschwemmungen wird zudem sauberes Wasser zum Gesundheitsfaktor – hier ist Prävention entscheidend. Auch in der Nutztierhaltung steigen durch Hitze und verunreinigtes Wasser Stress und Krankheitsanfälligkeit. Angesichts der fortschreitenden Erderwärmung und ihrer Auswirkungen auf die Ausbreitung von Infektionskrankheiten bleibt eine vorausschauende Pandemievorsorge unerlässlich – insbesondere die Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Gesundheit müssen dabei dauerhaft im Fokus stehen.
